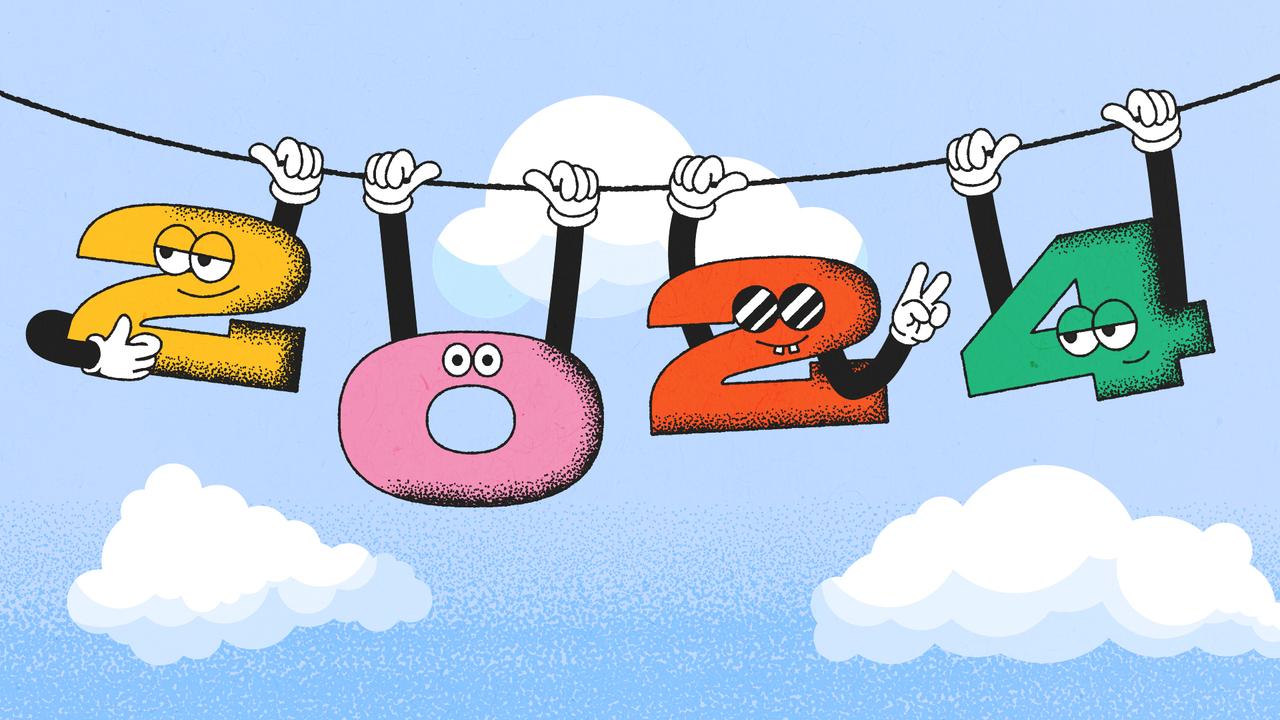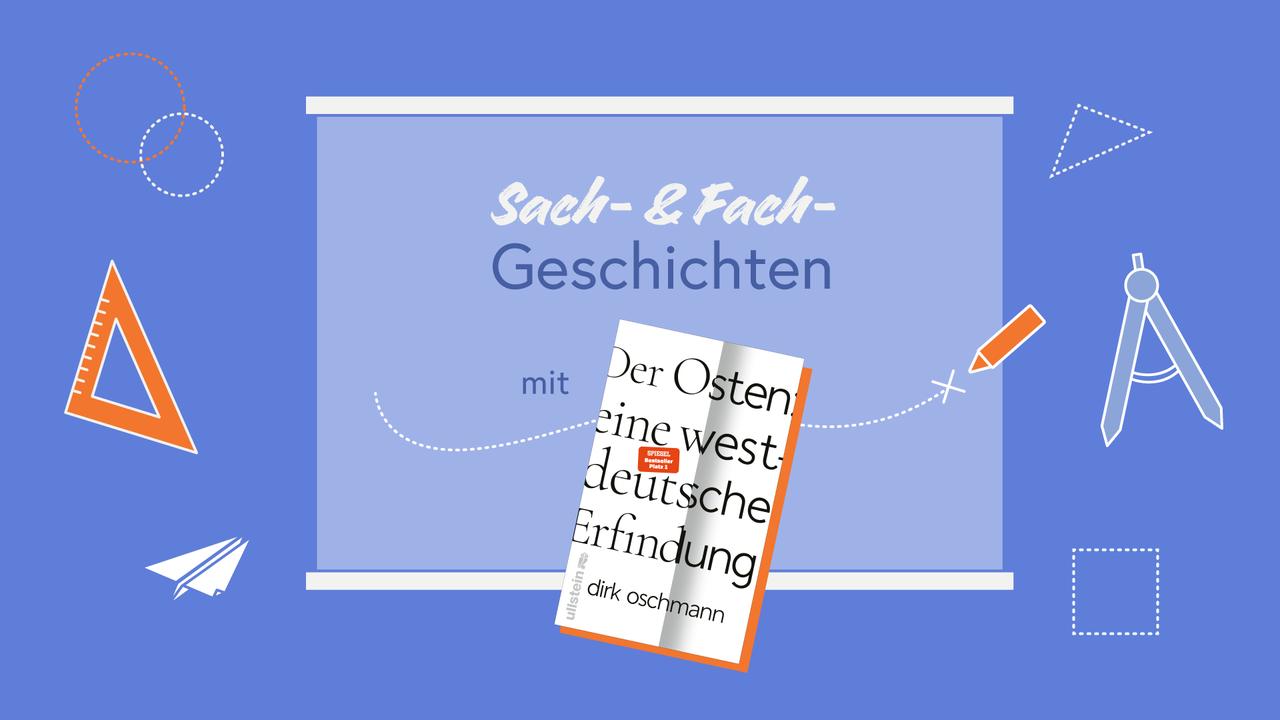Privatsphäre und Datenschutz regulieren das GeschäftUnderstanding Surveillance Capitalism | Teil 2
21.5.2025 • Gesellschaft – Text: Timo Daum, Illustration: Susann Massute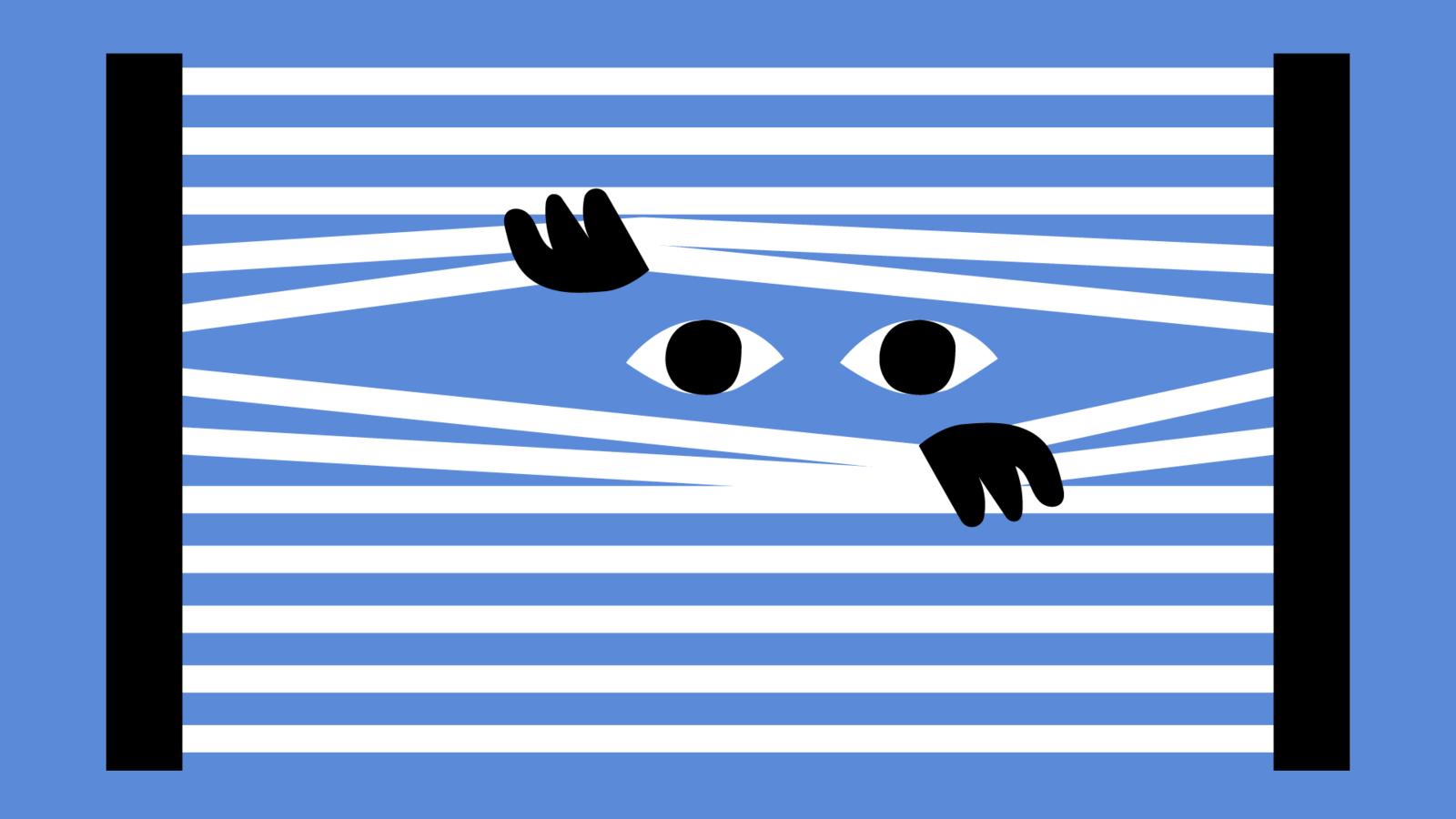
Gegen Überwachung – sei sie staatlich oder privat organisiert und exerziert – hilft nur der Schutz der Privatsphäre. Dies wiederum wird erreicht durch technische Mittel (z.B. privater Modus beim Browser), durch Gesetze (Datenschutzverordnung) oder auch durch individuelle Praktiken der Verweigerung („Ich hab gar kein Smartphone“).
So jedenfalls der common sense. Zwei Dinge geraten jedoch aus dem Blick: Erstens dass es bei Privacy und Datenschutz um den Schutz von Eigentum geht. Beim Datenschutz geht es nicht um den Schutz von Menschen, sondern – wie der Name schon sagt – um den Schutz von Daten, die eine bestimmte Form annehmen, nämlich Eigentum ihrer Eigentümerinnen und Eigentümer zu sein. Die zahlreichen Gesetze, Regeln und Praktiken rund um Privatsphäre sind nicht dazu bestimmt, Überwachungspraktiken zu verhindern, sondern sie – in erster Linie im Sinne der Mächtigen – zu regulieren und abzusegnen, lediglich illegale Exzesse strebt man an zu sanktionieren. Datenschutz sichert Eigentumsrechte und regelt deren Kommodifizierung und Vermarktlichung und sichert das reibungslose Funktionieren eines profitablen Datenmarkts.
Aber der Reihe nach.
Private sind nicht persönliche Daten
Wichtig ist an der Stelle zwischen Privatsphäre und persönlicher Sphäre, zwischen Privateigentum und persönlichem Eigentum zu unterscheiden. Die Autorin Sabine Nuss wird nicht müde zu betonen, dass mit „Privateigentum“ nicht persönliches Eigentum gemeint ist. Wenn sie das Privateigentum kritisiert, dann will sie nicht an unsere Wäsche – das ist unser persönliches Eigentum –, sondern an das Besitzen von Dingen, die eine bestimmte Form annehmen, nämlich die Warenform, und die für den Austausch auf dem Markt gedacht sind. Sie betont den „zentralen Unterschied zwischen produktivem Eigentum und konsumptivem Eigentum. Das erste bezeichnet die Verfügungsgewalt über die Mittel, mit denen eine Gesellschaft sich erhält und reproduziert (Produktionsmittel, Rohstoffe, Grund und Boden etc.), nur das ist Privateigentum. Das zweite beschreibt die Verfügungsgewalt über die Mittel, die dem individuellen Konsum dienen, das ist das persönliche Eigentum.“
Wo kommt die Vorstellung der Privatsphäre her?
Das Konzept der Privatsphäre hat seine Wurzeln im Schutz des Privateigentums, insbesondere der privaten Wohnung. Der bekannte Spruch „My home is my castle“, der auf den englischen Juristen und Politiker Edward Coke zurückgeht, bringt dies zum Ausdruck. Dieser Blick auf das Zuhause, wo man sich im Privaten sicher und geborgen fühlt, ist ein relativ neuer: Die Vorstellung, dass ein jeder das Recht habe, in seinem eigenen Zuhause tun und lassen zu können was er wolle, und wo weder andere noch der Staat das Recht hätten, sich einzumischen, ist eine Erfindung des Bürgertums.
Das Recht auf Privatsphäre taucht in der Rechtsprechung im vorindustriellen England auf. Hier wird der Schutz des privaten Raums vor staatlichen Eingriffen in die Eigentumsrechte des Einzelnen erstmals kodifiziert. Im Laufe der Zeit erweiterte sich das Verständnis von Privatsphäre über den Fokus auf physisches Eigentum hinaus. 1890 definierten Samuel Warren und Louis Brandeis in ihrem einflussreichen Artikel „The Right to Privacy“ in der Harvard Law Review Privatsphäre als „das Recht, in Ruhe gelassen zu werden“.
Diese Herkunft des Begriffs Privacy als Schutz des Privateigentums ist bis heute gültig. Privatsphäre wird als grundlegendes Eigentumsrecht verstanden, das es Einzelpersonen ermöglicht, ihre persönlichen Informationen und Daten zu kontrollieren. Sprich genauso zu behandeln wie andere Güter in Privatbesitz auch, inklusive der Möglichkeit, diese zu verkaufen, mit ihnen zu handeln.
Der Ursprung von Privatsphäre im Privateigentum des bürgerlichen Hausbesitzers deutet schon an, dass sie ein Herrschaftsverhältnis ausdrückt. Denn die Unverletzlichkeit der Wohnung, die hohen Hürden für staatliche Vertreter, die sich Zugang zur Privatwohnung verschaffen wollen – ein Richter oder eine Richterin muss einen Durchsuchungsbeschluss verfügen – gelten natürlich nur für diejenigen, die über ein solches Eigentum verfügen. Für Obdachlose, Mägde und Knechte, Kinder oder Sklaven und andere nicht vollgültige Bourgeois gilt sie nicht oder zumindest nicht im selben Masse. Privacy ist also historisch ein Privileg der Bessergestellten und drückt damit auch ein Herrschaftsverhältnis aus: Die Privatsphäre der einen wird auf Kosten derjenigen realisiert, die keine beanspruchen können.
Datenschutz schützt Datenbesitzer – nicht Menschen
Es gibt auch beim Datenschutz Herrschende und Beherrschte, Besitzer:innen und Besitzlose, Ausbeutende und Ausgebeutete. Die DSGVO spiegelt eine Zwei-Klassengesellschaft wider: Auf der einen Seite sind die Besitzenden von Infrastrukturen, die Daten verarbeiten („Verantwortliche“, „controller“). Sie bestimmen aus freien Stücken, über Zweck und Mittel der Datenverarbeitungspraxis. Sie sind die Herren über die digitalen Fabriken, in denen aus Rohdaten verwertbare Informationen hergestellt werden. Auf der anderen Seite stehen die Habenichtse, die „Opfer“ oder „Betroffene“, das sind all diejenigen, die geschützt werden müssen.
Artikel 6 der DSGVO deklariert sämtliche Datenverarbeitungsaktivitäten von Unternehmen und Personen, die aus reinem Profitinteresse und mit dem einzigen Ziel, Profit zu erzielen und für die Bereicherung derjenigen, die das Unternehmen – Überraschung! – ausdrücklich für legitim. Es spricht vom „berechtigten Interesse“, das es zu sichern, zu gewährleisten und zu verteidigen gilt. Die datenextraktiven Praktiken der Digitalkonzerne werden nicht etwa verboten. Im Gegenteil: Ihnen wird ein Segen erteilt, ihre Aktivität wird auch durch die ständige Rechtspraxis immer wieder für rechtens erachtet.
Das hört sich ganz anders an, als die Leser:innen das gewohnt ist? Das liegt daran, dass der Teil des Datenschutzes, der diese legalen Praktiken nicht abdeckt, meist im Zentrum der Debatte steht. Denn die Daten-Armen werden vor den Daten-Reichen geschützt, wenn diese über die Stränge schlagen, gar allzu schamlos sich bedienen bei dem kostenlosen Daten-Nektar. Wir werden vor unrechtmäßiger Ausbeutung geschützt, aber das tut der Tatsache keinen Abbruch, dass der Datenausbeutung gleichzeitig grundsätzlich ein Segen erteilt wird. Er bekommt den Anschein von Rechtmäßigkeit, wenn der irreguläre Zugriff verfolgt wird, auf dass der reguläre Zugriff reibungslos verlaufe!
Die Freiheit mitzumachen: Kritik an der Einwilligung
Niemand wird gezwungen, seine Daten, geschweige denn ohne Gegenleistung, herzugeben. Datendiebstahl oder ungefragte Aneignung sind gesetzlich verboten. Es sei denn, wir erteilen unsere Zustimmung. Auch dies regelt die DSGVO in Artikel 6, wo es um die Einwilligung in die Datenausbeutung geht. Wir müssen schon unterschreiben, sonst gilt der Vertrag nicht! Das Einverständnis in die Datenlogiken funktioniert analog mit der Unterschrift unter einen Arbeits- oder Mietvertrag: Ich tue es aus freien Stücken, niemand zwingt mich dazu – außer die Verhältnisse, aber dazu gleich.
Mit jeder Zustimmung auf Webseiten, bei der App-Nutzung usw. machen wir einen Kotau vor den datenextraktiven Verhältnissen, stimmen aus freien Stücken der Aneignung durch die Datenkapitalisten zu. Ein Geniestreich, denn mit einer Unterschrift wird alles oben Genannte legal, denn man hat ja freiwillig eingewilligt. Und schon ist die Datenausbeutung nicht nur legal, ich habe auch noch zugestimmt. Und wir gehen ständig solche Verträge ein. Der Jurist und Datenschutzaktivist Malte Engeler erklärt in einem Beitrag auf netzpolitik.org, bis heute werde Datenschutz mit der Erteilung von Einwilligungen gleichgesetzt. „Statt die strukturellen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen einer allgegenwärtigen Datenverarbeitung in den Blick zu nehmen, lag und liegt der Fokus allein auf einer Stärkung der Entscheidungsmacht des Individuums. Die Einwilligung ist nur in einer utopischen Welt ohne Machtungleichgewicht ein Ausdruck von Selbstbestimmung.“
Was vielen wiederum ein schlechtes Gewissen macht, wenn wieder ein Nerd kommt und uns konfrontiert mit unserer schlechten Konsumentscheidung – Microsoft statt Libre Office, Google Maps statt Open Street Maps, WhatsApp statt Signal, macOS statt Linux usw. Wie mit dem ökologischen Fußabdruck ist es auch mit unserer Datenspur: Das Gesetz und auch die Kritiker:innen lassen das Ganze als persönliche Konsumentscheidung erscheinen. Dabei ist es mal wieder der „stumme Zwang der Verhältnisse“, der uns immer wieder zu diesen Entscheidungen zwingt.
Der doppelt freie Datenbesitzer
Hier drängt sich die Parallele mit dem Arbeiter bei Marx förmlich auf: Der freie Arbeiter ist in der bürgerlichen Gesellschaft, wie Marx es formulierte, doppelt frei: Er sei erstens frei „von den alten Klientel- oder Hörigkeitsverhältnissen und Dienstverhältnissen und zweitens frei von allem Hab und Gut und jeder objektiven, sachlichen Daseinsform, frei von allem Eigentum“ (Karl Marx, Das Kapital. Erster Band (1867), in: MEW, Bd. 23, Berlin 1995, S. 183).
Ähnlich verhält es sich mit dem Dateneigentümer: Er ist doppelt frei, frei zu entscheiden, was mit seinen oder ihren Daten geschehen soll, niemand kann ihn oder sie zwingen, bei Facebook mitzumachen. Andererseits hat er oder sie auch keinerlei Einfluss oder Mitspracherecht geschweige denn Miteigentum an den datenextraktiven Fabriken bzw. den digitalen Infrastrukturen unsere Zeit. Er oder sie kann seine oder ihre Daten hergeben oder auch nicht. Und das heißt heute: Er oder sie kann mitmachen oder aber von weiten Teilen von gesellschaftlichem Leben ausgeschlossen zu sein: eine vergiftete Wahl.
Fazit
Bei der Datenschutzgrundverordnung geht es darum, den Handel mit Daten zu erlauben, zu regeln und ihn – auch aus privatem Profitinteresse – als legitimes Rechtsgut zu verankern. „Es geht alles mit rechten Dingen zu“, aber es ist deshalb nicht gerecht oder gerechtfertigt, fair oder richtig. Mehr Datenschutz nach dem Motto: „Meine Daten gehören mir!“ zementieren dieses Eigentumsvorstellung nur. Zum Besitz einer Ware gehört das Recht, frei darüber verfügen zu können, insbesondere, sie verkaufen zu dürfen. Datenschutzregeln zielen denn auch in erster Linie auf einen funktionierenden digitalen Datenmarkt, nicht auf den Schutz des Individuums vor Betrug, Missbrauch und Belästigung. Datenschutz fokussiert im Kern auf die Sicherung eines profitablen Datenmarkts. Um dieses Ziel zu erreichen, holt er sich das Einverständnis in die Datenverarbeitung ein. Unter dem stummen Zwang der digitalen Verhältnisse kommt so immer wieder aufs Neue ein Vertrag zwischen formal Gleichen, aber real in höchstem Maße Ungleichen, zustande.
Quellen
Warren/Brandeis: The right to privacy. Erschienen 1890 im Harvard Law Review.
Malte Engeler: Die Einwilligung ist das Problem. Erschienen am 3.8.2021 auf Netzpolitik.org.
Sabine Nuss, Sabine. Wessen Freiheit, welche Gleichheit?: Das Versprechen einer anderen Vergesellschaftung. Berlin: Dietz, 2024.